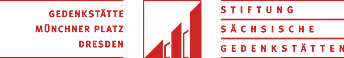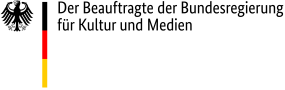Gedenkstätte Münchner Platz Dresden widmet sich den „Erben der Vertreibung“
18.11.25

Vor 80 Jahre endete mit dem Zweiten Weltkrieg die nationalsozialistische Herrschaft, die Millionen von Menschen ermordet, „umgesiedelt“, verschleppt und ins Exil getrieben hatte. 1945 folgte eine weitere Vertreibungswelle: Dieses Mal traf es in großem Umfang deutsche Bevölkerungsgruppen in Ost- und Südosteuropa. Wie lebt die Erinnerung an Krieg und Vertreibung aus der Nachkriegs-Tschechoslowakei bei den Kindern und Enkeln der vertriebenen Sudetendeutschen fort? Dieser Frage ging eine Veranstaltung der Gedenkstätte Münchner Platz Dresden im Rahmen der Tschechisch-Deutschen Kulturtage nach.
Kurz vor Veranstaltungsbeginn am Abend des 13. November 2025 wurden noch eilig Klappstühle herangeschafft. Noch den letzten Winkel des Veranstaltungsraum der Gedenkstätte belegten die rund 80 Besucherinnen und Besucher. Gedenkstättenleiterin Dr. Birgit Sack zeigte sich bei ihrer Begrüßung „überwältigt vom großen Zuspruch“. Die Vermutung des Podiumsgastes Ralf Pasch, dass die meisten im Saal auch aufgrund der eigenen Familiengeschichte gekommen waren, bestätigte sich, als er in den Saal rief: „Wer hat einen Vertriebenen- oder Flüchtlingshintergrund?“ Zwei Drittel der Hände gingen hoch. Die „Erben der Vertreibung“ saßen nicht nur vorne in der Diskussionsrunde – sondern auch im Publikum.
Ralf Pasch, Jahrgang 1967, aufgewachsen in Schmalkalden in der DDR, stammt selber aus einer sudetendeutschen Familie. Sie gehörte zu den rund drei Millionen Deutschen, die ab 1945 aus der wieder begründeten Tschechoslowakei auf Grundlage der sogenannten Beneš-Dekrete ausgewiesen wurden. Paschs Großvater (1913-1999) war am Fuß des Riesengebirges aufgewachsen. Dieser Opa war für Pasch, der früh seinen Vater verlor, eine prägende Person. „900 Seiten, auf Schreibmaschinenpapier getippt, hat er mir als Memoiren hinterlassen“, erzählte Pasch. Darin finden sich auch verstörende Sätze: Die Tschechen, so schrieb er etwa, seien ein „Volk, das über keine eigene Kultur verfügt“. Er habe verstehen wollen, wie sein Großvater gedacht habe, auch politisch. Denn dieser Großvater war als Mitglied der Sudetendeutschen Partei (SdP) und später der NSDAP auch Teil der nationalsozialistischen Bewegung. „Wir müssen es aushalten, dass unsere Großeltern nicht nur Opfer, sondern oft auch Täter waren“, sagte Pasch.
Die eigene sudentendeutsche Familiengeschichte bewog Ralf Pasch dazu, andere Nachkommen von Vertriebenen nach ihren Geschichten zu fragen. Daraus entstand das Buch „Die Erben der Vertreibung. Sudetendeutsche und Tschechen heute“ – erstmals 2014, in zweiter Auflage 2022 erschienen und bereits wieder vergriffen. In dem Buch kommen 15 Menschen aus Deutschland – Ost wie West –, Tschechien und Österreich zu Wort. Sie gehören allesamt der zwischen 1960 und 1980 geborenen „Enkelgeneration“ an, deren Großeltern die Vertreibung auf die eine oder andere Art erlebt haben. Pasch wollte wissen: Wie haben Erzählungen zu Krieg und Vertreibung ihr Leben beeinflusst – oder auch nicht? Zwei der damals befragten Personen saßen nun mit ihm in einem Gesprächskreis, moderiert von Gedenkstättenleiterin Birgit Sack.
Für den aus Gera stammenden Künstler Erik Buchholz, Jahrgang 1969, war das Thema „Vertreibung“ im Familienkreis sehr präsent, obwohl er die Erzählungen seiner früh verstorbenen Großeltern gar nicht mehr selber hören konnte. „Man sprach in meiner Familie von ‚daheeme‘, verfiel in die Mundart“, erzählte Buchholz. Da sei eine große Sehnsucht in ihm entstanden. Mit 14 Jahren reiste er zum ersten Mal in den Geburtsort seiner Mutter Adřspach/Adersbach – er wollte „bewahren und aufschreiben“. In der DDR war die gewaltsame Vertreibung der deutschsprachigen Bevölkerung ein Tabuthema, die in der Bundesrepublik erscheinenden Zeitschriften der Vertriebenenverbände als „revanchistisch“ verschrien – und für den jungen Buchholz unerreichbar. „Die kamen nicht mit den Weihnachtspaketen aus dem Westen“, sagte Buchholz.
1991 fuhr Buchholz erstmals nach Forchheim (Oberbayern) zum „Heimattag“ des Heimatkreises für das Braunauer Land (Broumovská vrchovina), aus dem seine Familie stammte. Mittlerweile betreut er selber den Heimatkreis und versucht – im Gespräch mit dem Bürgermeister von Forchheim – das Braunauer Heimatmuseum für die Zukunft zu retten. Gleichzeitig widmet er sich in enger Zusammenarbeit mit tschechischen Unterstützern wie der lokalen Feuerwehr der Pflege des alten Friedhofs im Heimatort seiner Großeltern.
Im Gegensatz zu Ralf Pasch und Erik Buchholz stammt der Historiker Tomáš Okurka (Jahrgang 1977) aus einer tschechischen Familie. Diese ließ sich nach dem Zweiten Weltkrieg im bis 1945 von Deutschen dominierten Liberec (Reichenberg) nieder. Wie er erzählte, wurde in seiner Familie kaum je über die Vertreibung der deutschsprachigen Bevölkerung gesprochen. Ab seinem Studium widmete sich Okurka jedoch intensiv der Geschichte der deutschen Bevölkerungsgruppe in Böhmen. Seit 2021 ist die maßgeblich von ihm entwickelte Ausstellung „Naši Němci – Unsere Deutschen“ im Stadtmuseum in Ústí nad Labem zu sehen. Dort gehe es um das jahrhundertelange Zusammenleben deutsch- und tschechischsprachiger Menschen im Sudetenland, erklärte er. Auch wenn dabei die „Schattenseiten“ nicht ausgespart würden, sei es ihm vor allem darum gegangen, positive deutsch-tschechische Beziehungsgeschichten zu erzählen.
Gedenkstättenleiterin Birgit Sack wollte abschließend von Tomáš Okurka wissen, wie er in die Zukunft der deutsch-tschechischen Beziehungen blickt. „In den letzten Jahren war ich ziemlich optimistisch, was die Frage der Auseinandersetzung mit der Vertreibung der Deutschen aus Tschechien angeht“, sagte Okurka. In Hinblick auf die künftige tschechische Regierung, deren Zustandekommen freilich noch nicht feststehe, sei er jedoch in Sorge. Diese wolle die Beziehungen zu Europa schwächen, „da könnte es eine gefährliche Entwicklung geben“. Was ihn aber weiterhin optimistisch stimme: „Es gibt jetzt in Tschechien keine so starke antideutsche Stimmung mehr wie noch vor etlichen Jahren.“

In der anschließenden Diskussion meldeten sich zahlreiche Personen aus dem Publikum zu Wort. Es waren meist Kinder und Enkel von Vertriebenen, die von ihrer Familiengeschichte erzählten und nach dem Gelingen von deutsch-tschechischer „Versöhnung“ fragten. Auch wenn wiederholt von brutaler Gewalt im Zuge der Vertreibungen die Rede war, forderte keiner der Anwesenden Entschädigungszahlungen von tschechischer Seite. „Käse“ sei das, meinte einer: Der Blick müsse in die Zukunft gehen, auch wenn ihn die Vorstellung schmerze, dass sich fremde Menschen in das „warme Bett“ seiner Mutter gelegt hätten. Ein Besucher der Veranstaltung hob hervor, dass es ihn beeindruckt habe, wie die Teillnehmer der Diskussionsrunde sich aus der familiären Opferrolle gelöst hätten und damit von „passiven zu aktiven Erben“ geworden seien. Dieser Gedanke gefiel auch Ralf Pasch. „Wir brauchen diese Offenheit, um das nicht Gelöste herauszufinden“, sagte er. Er wünsche sich diese Offenheit auf deutscher wie auf tschechischer Seite. „Auf tschechischer Seite ist die Lebendigkeit des Themas allerdings größer als auf deutscher.“
Ralf Pasch: Sudetendeutsche und Tschechen heute. Die Erben der Vertreibung, Mitteldeutscher Verlag, 232 Seiten, Erstausgabe 2024, 2. Auflage 2022 (bereits vergriffen)
Kontakt
Volker Strähle (Referent Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit)
0351 46331992
volker.straehle@stsg.de