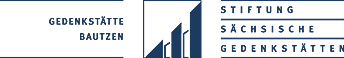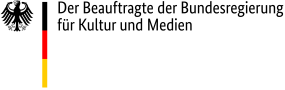Das Erbe politischer Haft: Kinder und Enkel erzählen, was die Haft ihrer (Groß-)Eltern im „Stasi-Knast“ Bautzen II für sie bedeutet – Filmpremiere

Datum:
Veranstalter:
Gedenkstätte BautzenOrt:
Gedenkstätte Bautzen, Weigangstraße 8a, 02625 Bautzen
Was bedeutet es, wenn die eigenen (Groß-)Eltern aus politischen Gründen in der DDR inhaftiert waren? Dieses bisher wenig beachtete Thema der DDR-Geschichte nimmt die Gedenkstätte Bautzen jetzt in den Blick. Wann und wie haben die Kinder von der Haft Ihrer (Groß-)Eltern erfahren? Warum waren ihre Angehörigen inhaftiert? Was hatte die Haft für konkrete Folgen für die Familie? Wurde über die Haftzeit gesprochen? Wie haben diese Erfahrungen die Lebenswege der Kinder und Enkel beeinflusst? Entstanden ist ein Film über Verlust, Ohnmacht, Hoffnung und Neubeginn.
Elf Kinder und Enkel der ehemaligen Häftlinge der Stasi-Sonderhaftanstalt Bautzen II erzählen über die Bedeutung für sie. Ihre Eltern und Großeltern waren in den 1950er- und 1960er-Jahren (Karl Wilhelm Fricke, Walter Janka, Gustav Just, Erich Loest), den 1970ern (Manfred Matthies) und den 1980ern (Gerhard Bause) inhaftiert. Die Interviewten empfinden die Haft ihrer (Groß-)Eltern als Ereignis, das ihr Leben bis heute nachhaltig prägt.
Aus dem rund zwanzigstündigen Filmmaterial ist eine einstündige Film-Installation entstanden, die in der Gedenkstätte Bautzen präsentiert wird. Die Interviews führten Silke Klewin (Leiterin der Gedenkstätte Bautzen) und Cornelia Bruhn (Zeitzeugenbüro der Gedenkstätte Bautzen). Beratend an der Erstellung des Interviewleitfadens tätig war Dr. Maya Böhm, Berlin (Psychologin). Technisch umgesetzt wurde die Installation durch KRRO Film, Berlin. Gefördert wurde das Projekt durch den Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien sowie durch den Freistaat Sachsen aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.
Im Anschluss an die Filmpremiere lädt die Gedenkstätte zum Gespräch mit den Angehörigen und zum Empfang. Der Eintritt ist frei.
ZUSATZINFORMATIONEN
Hintergrund
Das Erbe politischer Haft in der DDR kann sich für die nächsten Generationen ganz unterschiedlich zeigen: durch posttraumatische Belastungsstörungen, Schuld, Scham, Schweigen, aber auch eine höhere Resilienz und ein starkes gesellschaftliches Verantwortungsbewusstsein. Die psychologische und sozialwissenschaftliche Forschung widmet sich diesen Fragen seit geraumer Zeit und markiert diese als ernstzunehmende gesellschaftliche Faktoren, die auch politische Mentalitäten prägen.
Der Podcast zum Film "Das Erbe politischer Haft"
von Uwe Tschirner in Lausitz heute mit der Leiterin der Gedenkstätte Bautzen, Silke Klewin
Die Inhaftierten und ihre im Projekt interviewten Kinder und Enkel
Gerhard Bause (*1961) verfasste ein Protestschreiben für die Freilassung der im Zuge der Luxemburg-Liebknecht-Demonstration im Januar 1988 zu Unrecht inhaftierten Bürgerrechtlerinnen und Bürgerrechtler. Er wird mit seiner Frau Dorit Bause im Februar 1988 festgenommen. Sein Urteil lautet nach § 214 StGB DDR: für ihn ein Jahr und zehn Monate, für seine Frau Dorit sechs Monate. Gerhard Bause wird in Bautzen II inhaftiert und am 14.11.1989 nach einer Amnestie von dort entlassen. Die beiden Töchter des Ehepaars Bause werden nach der Haft geboren. Die ältere Tochter stößt durch ihre Nachfrage den Prozess der Aufarbeitung der Eltern an. Die intensive Beschäftigung der Eltern mit dem Thema wirkt sich stark auf die Familiendynamik und das Geschichtsbewusstsein der Töchter aus.
Karl Wilhelm Fricke (*1929), freier Journalist in West-Berlin, spezialisiert sich auf die Berichterstattung über die politische Verfolgung in der DDR. Fricke wird 1955 von der Stasi gewaltsam aus West-Berlin nach Ost-Berlin entführt und nach Artikel 6 der DDR-Verfassung wegen „Boykott- und Kriegshetze“ zu vier Jahren Haft verurteilt. Seine gesamte Haftzeit verbringt er in Einzelhaft, bis er 1959 nach West-Berlin entlassen wird. Seine Enkelin begleitet ihn als Erwachsene zu Medieninterviews und nimmt starken Anteil an seiner Geschichte.
Walter Janka (1914–1994) ist vor seiner Inhaftierung Leiter des Aufbau-Verlages, Gustav Just (1921–2011) stellv. Chefredakteur des „Sonntag“ und Erich Loest (1926–2013) freier Journalist und Schriftsteller. Sie diskutieren darüber, das sozialistische System unter Walter Ulbricht zu demokratisieren und zu reformieren. Dafür werden sie verurteilt. Ihre Prozesse gehören zu einer Reihe von Schauprozessen, die von der SED gegen führende Reformsozialisten inszeniert werden. Das Urteil für Janka und Just im Juli 1957 lautet wegen „Verbrechens gemäß Art. 6 der Verfassung der DDR“ (Boykotthetze“) vier und fünf Jahre Zuchthaus. Loest wird im Dezember 1957 aufgrund von „Staatsverrat“ zu siebeneinhalb Jahren Zuchthaus verurteilt. Janka und Just werden 1960, Loest 1964 aus Bautzen II entlassen. Just tritt 1992 als Alterspräsident des Brandenburgischen Landtags und Vorsitzender der Verfassungskommission zurück, als öffentlich (erneut) bekannt wird, dass er 1941 an der Erschießung von Zivilistinnen und Zivilisten i. d. Ukraine beteiligt war. Die Kinder von Janka, Just und Loest erlebten im Kindesalter alle drei die Verhaftung ihres Vaters. Die verlorene Zeit hinterlässt deutliche Spuren in der Bindung zum Vater. Die Enkel von Janka und Just erleben ihren Großvater als sehr nahbaren Menschen.
Manfred Matthies (1941–2025) verhilft nach dem Mauerbau von West-Berlin aus bis zu 80 DDR-Bürgerinnen und -Bürgern zur Flucht. 1972 wird er bei einer dieser Aktionen festgenommen und wegen „staatsfeindlichen Menschenhandels“, „Spionage“ und „Terror“ zu 13 Jahren Haft verurteilt. 1976 kauft die Bundesrepublik ihn frei. Er arbeitet fortan als Architekt. Seine älteste Tochter erlebt die plötzliche Abwesenheit des Vaters als sehr schmerzhaft. Ihr sind die psychischen Haftfolgeschäden des Vaters sehr präsent. Nach der Haft lernt Matthies seine zweite Frau kennen. Die jüngere Tochter, obwohl nach der Haft geboren, spürt zeitlebens eine große Barriere, wenn sie versucht ihrem Vater emotional näher zu kommen.
Kontakt
Susanne Hattig (Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit Gedenkstätte Bautzen)
Tel: 03591 530363
susanne.hattig@stsg.de