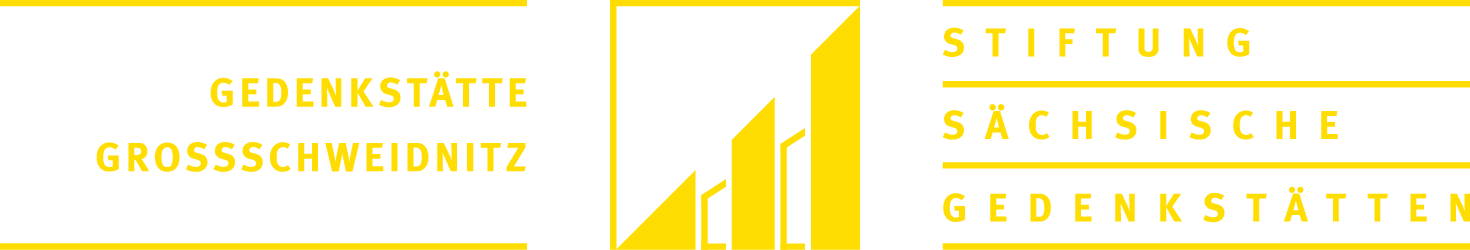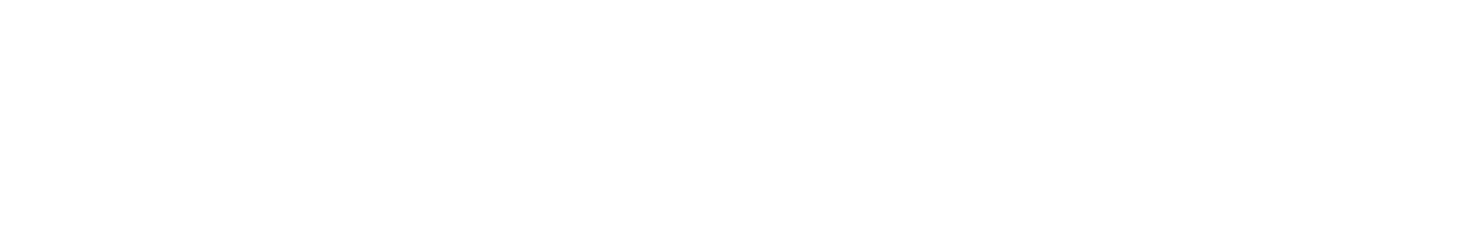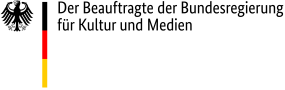Bildung
Für Lehrkräfte und Mitarbeitende des Gesundheits- und Sozialwesens bietet die Gedenkstätte Fortbildungen an.
Wir empfehlen Ihnen eine telefonische Vorabsprache (03585-2113511) des von Ihnen gewünschten Termins mindestens drei Wochen im Voraus. Absagen sind spätestens zwei Tage vor dem Termin schriftlich mitzuteilen.
Bitte beachten Sie:
- Die Teilnehmendenzahl bei Führungen sollte 20 Personen nicht überschreiten.
- Die Aufsichtspflicht für minderjährige Personen liegt auch während des Besuches der Gedenkstätte bei den Begleitpersonen.
- Absagen von Führung/Projekten müssen spätestens zwei Tage vor dem Termin schriftlich erfolgen. Anderenfalls wird Ihnen eine Aufwandsentschädigung von 50,00 € pro Gruppe in Rechnung gestellt.
Kosten
Führungen und Projekte sind für Schulen und Bildungsträger kostenfrei.
Die Höhe der Aufwandsentschädigung für alle anderen Gruppen entnehmen Sie bitte dem Kostenverzeichnis. Wir bitten um Vorkasse. Die Rechnung geht Ihnen nach Terminbestätigung zu.
Fahrtkostenerstattung
Das Sächsische Kultusministerium fördert Klassenfahrten zu Gedenkstätten im Freistaat Sachsen. Mehr Informationen erhalten Sie dazu bei der Landesservicestelle „Lernorte des Erinnerns und Gedenkens“.
Überblick über unsere Bildungsangebote:
Projekte
Die Projektarbeit in Kleingruppen ermöglicht die Vertiefung ausgewählter Themen der Ausstellung. Neben dem Erwerb historischen Wissens sollen Methodenkompetenz (Medien- und Quellenkritik) und Urteilskompetenz durch multiperspektivische Annäherung (Akteurinnen und Akteure/Betroffene) und Kontroversität gefördert werden.
Nach einem Einführungsvortrag setzen sich die Teilnehmenden selbstständig mit Dokumenten, Biografien von Akteurinnen und Akteuren und Opfern sowie Objekten der Ausstellung auseinander. Gedenkstättenmitarbeitende unterstützen bei der Recherche und Einordnung. Im Anschluss werden die Ergebnisse dem Plenum präsentiert.
Für weitere inhaltliche Absprachen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung: grossschweidnitz@stsg.de.
- Teilnehmendenzahl: max. 30
- Altersempfehlung: ab Klasse 8 (Oberschule), ab Klasse 9 (Gymnasium)
Die Gesundheits- und Bevölkerungspolitik bildete den ideologischen Kern des Nationalsozialismus. Sie basierte auf rassenhygienischen Überzeugungen, die definierten, wer Teil der „Volksgemeinschaft“ sein sollte und wer nicht. Psychisch kranke und geistig behinderte Menschen wurden ausgegrenzt und verfolgt. Am Beispiel nationalsozialistischer Propaganda und konkreter Maßnahmen wie der Zwangssterilisation „Erbkranker“ wird die NS-Gesundheitspolitik vor Beginn der Krankenmorde beleuchtet und Mechanismen der Ausgrenzung aufgezeigt.
2. „Lebensunwertes Leben“. NS-Krankenmorde in Großschweidnitz 1939 – 1945 (min. 4 Stunden)
- Teilnehmendenzahl: max. 30
- Altersempfehlung: ab Klasse 8 (Oberschule), ab Klasse 9 (Gymnasium)
Das Projekt beleuchtet die Rahmenbedingungen und die konkrete Umsetzung der Krankenmorde in Großschweidnitz und schafft regionale Anknüpfungspunkte. Es werden Handlungsspielräume der Schwestern und Pfleger beleuchtet, ebenso wie individuelle Schicksale von Opfern, die aus unterschiedlichsten Gründen in das Räderwerk der NS-Psychiatrie gerieten.
3. Koffer öffnen - Lebensgeschichten entdecken. Biografien von Opfern der NS-Krankenmorde
- Teilnehmendenzahl: max. 30
- Altersempfehlung: ab Klasse 8 (Oberschule), ab Klasse 9 (Gymnasium)
In diesem Projekt stehen individuelle Lebensgeschichten im Mittelpunkt, die einen personenzentrierten Zugang zur Geschichte der nationalsozialistischen Krankenmorde ermöglichen. In Kleingruppen setzen sich die Teilnehmenden mit Biografien von Opfern auseinander. „Biografische Koffer“ mit Fotos, Dokumenten und Gegenständen ermöglichen eine Annäherung an die Personen, ihre Interessen und Schicksale. Durch haptische Objekte und Schriftquellen (Faksimiles) aus Patientenakten, werden die Biografien erfahrbar.
Die Beschäftigung mit den Lebensgeschichten regt zur Auseinandersetzung mit Fragen historischer Verantwortung sowie dem heutigen Umgang mit Ausgrenzung und Vielfalt an.
4. Pflege im Nationalsozialismus. Die Beteiligung von Pflegepersonal an den nationalsozialistischen Krankenmorden (min. 5 Stunden)
- Teilnehmendenzahl: max. 30
- Altersempfehlung: Auszubildende und Personen im Gesundheits- und Sozialwesen (Weiterbildung)
Die Mitarbeit von Pflegepersonal war wesentlich für die Umsetzung der nationalsozialistischen Krankenmorde. Pfleger und Schwestern beteiligten während der „Aktion T4“ sich am Transport der Opfer und führten sie in die Gaskammer. In der dezentralen Phase der Krankenmorde wirkten sie direkt an der Selektion mit und verabreichten gezielt überdosierte Medikamente.
In Kleingruppen lernen die Teilnehmenden Formen der Mitwirkung des Pflegepersonals an den Krankenmorden in Pirna-Sonnenstein und Großschweidnitz kennen, aber auch den historischen Arbeitskontext, das Berufsbild und Formen der Stigmatisierung von psychisch kranken oder geistig beeinträchtigten Menschen. Das historische Wissen ermöglicht eine tiefgehendere Reflexion gegenwärtiger berufsethischer An- und Herausforderungen in pflegenden Berufen.
Das Projekt kann in verkürzter Form (ohne Projektarbeit) auch als Schwerpunktführung gebucht werden. Diese umfasst einen geführten Rundgang durch die Ausstellung und über das Gelände des heutigen Fachkrankenhauses (Dauer min. 3 Stunden).
5. „Wir fordern schwerste Bestrafung“. Strafverfolgung nach 1945 (min. 4 Stunden)
- Teilnehmerzahl: max. 30
- Altersempfehlung: ab Klasse 11
Die Nachwirkungen der Krankenmorde waren vielfältig. Auf der einen Seite kam es zur Strafverfolgung einiger Beteiligter, auf der anderen Seite stand die fehlende Wiedergutmachung und Anerkennung des Leides der Opfer und deren Angehöriger. Wie rechtfertigten sich die Täter und Täterinnen, wie versuchten sich die Opfer und deren Angehörige Gehör zu verschaffen und wie verhielt sich die Gesellschaft? Welcher politische Kontext bestimmte die Erinnerung und das (ausgebliebene) Gedenken an die Opfer der Krankenmorde?
6. Bioethische Fragen heute (derzeit in Überarbeitung, nicht buchbar)
- Teilnehmendenzahl: max. 30
- Altersempfehlung: ab Klasse 11, Auszubildende Gesundheits- und Sozialberufe
Die Ausstellung greift aktuelle bioethische Fragen, die sich zum Beispiel im Zusammenhang mit der Pränataldiagnostik stellen, auf. Im Rahmen des Projektes können diese anhand verschiedener Themen vertieft und diskutiert werden. Wie gehen wir heute mit Behinderung und psychischen Erkrankungen um, welche Barrieren gibt es? Wie gehen wir in Krisensituationen mit den Schwächsten der Gesellschaft um?
Gern beraten wir Sie zu unseren unterschiedlichen Angeboten und Formaten.
Kontakt:Dr. Maria Fiebrandt (Referentin für wissenschaftliche Dokumentation, Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit)
Tel: 03585-2113511
Maria.Fiebrandt@stsg.de
Christoph Hanzig, M. A. (Referent für Bildungsarbeit)
Tel: 03585-2113511
Christoph.Hanzig@stsg.de