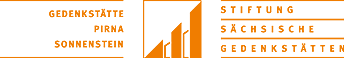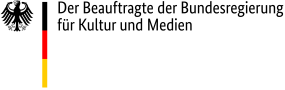Rückblick auf die Frühjahrstagung 2025 des Arbeitskreises zur Erforschung der NS-„Euthanasie“ und Zwangssterilisation in Pirna
13.05.25

Vom 9.bis 11. Mai 2025 hatte die Gedenkstätte Pirna-Sonnenstein zur Frühjahrstagung des Arbeitskreises zur Erforschung der NS-„Euthanasie“ und Zwangssterilisation geladen. Rund 100 Gäste folgten dieser Einladung.
Anlass für die Einladung nach Pirna war das 25-jährige Bestehen der Gedenkstätte – Zeit, einen Blick zurück auf das Erreichte, aber auch auf neue Herausforderungen zu werfen. Über 100 Interessierte aus verschiedensten Bereichen – Gedenkstätten, Universitäten, Bildungseinrichtungen, medizinischen Einrichtungen aber auch Angehörige von „Euthanasie“-Opfern – kamen für drei Tage zusammen, um die Gedenkstätte Pirna-Sonnenstein kennenzulernen und sich über aktuelle Themen und neue Forschungsergebnisse auszutauschen.
Die Veranstaltung begann mit einem Rückblick auf die ersten Forschungsarbeiten in Pirna, die Ende der 1980er-Jahre von einem Schüler angestoßen wurden. Thomas Schilter war dieser Schüler, der den NS-Krankenmord zum Thema machte und erreichte, dass die Ausstellung „Aktion T4“ des Westberliner Historikers Götz Aly auch in Pirna gezeigt wurde. Er berichtete vom Vergessen, Unwissen und Nicht-Wissen-Wollen in Pirna und der Suche nach dem authentischen Ort der Morde und der Gründung des Kuratoriums Gedenkstätte Sonnenstein, die die Keimzelle der im Jahr 2000 eröffneten Gedenkstätte wurde. Welche Projekte diese in den Folgejahren anstrengte und wie die Bildungsarbeit aufgebaut wurde, darüber berichteten am Samstag Hagen Markwardt und Melanie Wahl von der Gedenkstätte Pirna-Sonnenstein. Auch Herausforderungen, vor denen die Gedenkstätte heute steht, wurden benannt: ein deutlicher Besucheranstieg, der die Kapazitätsgrenzen aufzeigt, nach mehr personellen Ressourcen verlangt und auch die Notwendigkeit einer neuen, inklusiveren Ausstellung waren neben den politisch-gesellschaftlichen Herausforderungen einige der Themen. Politische Rahmenbedingungen und die aktuelle Erinnerungspolitik waren auch Gegenstand der Diskussion zum Bundestagsbeschluss über die Anerkennung der Opfer von NS-„Euthanasie“ und Zwangssterilisation Anfang 2025. Welche konkreten Ergebnisse kann dieser haben, wie kann die Aufarbeitung zielführend intensiviert werden? Dazu will sich der Arbeitskreis und seine Mitglieder, die über eine vielfältige Expertise verfügen, konkret einbringen. Und noch weiteres aktuelles Thema stand auf dem Programm: Wie umgehen mit rechtsextremen Angriffen auf die Erinnerungskultur? Ein Impuls von Magdalene und Maria Heuvelmann lieferte aufschlussreiche Analysen und Ideen, wie Gedenkstätten, aber auch jeder Einzelne auf diese politischen Herausforderungen reagieren kann.
Bei Rundgängen über das ehemalige Anstaltsgelände und durch die Gedenkstätte konnten die Teilnehmenden die wechselvolle Geschichte des Ortes kennenlernen: von der ersten Heilanstalt im Deutschen Reich, über die NS-Tötungsanstalt bis hin zur Flugzeugentwicklung und rigiden Abschirmung des Geländes in der SBZ/DDR.
Einen weiteren Teil der Tagung bildeten Vorträge, die einen Einblick in die aktuelle Forschung und Projekte zum Thema NS-Krankenmord gaben. Beate Mitzscherlich stellte gemeinsam mit den Studierenden Una Gotthardt und Laura Franziska Lech ihre Erkenntnisse zu Opfern der „Kindereuthanasie“ in Zwickau und ein daraus hervorgegangenes Bildungsangebot vor. Fabian Krause präsentierte die Ergebnisse seiner akribischen Forschung zum Bezirkspflegeheim Saalhausen/Freital in der NS-Zeit. Einen Einblick in genalogische Recherchemöglichkeiten gab Inga Gutzeit. Stefan Kiefer beleuchtete Handlungsspielräume während der Krankenmorde und Nachkriegsmythen am Beispiel einer Anstaltsbeschäftigten, die angeblich 1940 in der Tötungsanstalt Grafeneck vorstellig geworden war. Katrin Kasparek gewährte einen Einblick in ihre Forschungen zum Nürnberger Westfriedhof und die dorthin gelieferten Urnen aus „T4-Tötungsanstalten“. Harald Jenner stellte die in den Alsterdorfer Anstalten geführte Erbgesundheitskartei vor. Robert Parzer lenkte den Blick über Deutschland hinaus und widmete sich in seinem Vortrag dem polnischen Anstaltspersonal, dessen Rolle während der Krankenmorde im deutsch besetzten Polen mindestens ambivalent war. Michal Simunek stellte die neueste tschechische Veröffentlichung zu den Krankenmorden im okkupierten Böhmen-Mähren vor („Orbite des Todes“), die hoffentlich bald auch in deutscher Sprache vorliegen wird.
Die Tagung brachte viele Interessierte zusammen und machte deutlich, dass in der Aufarbeitung und Vermittlung der NS-Krankenmorde viel passiert, viele neue Ansätze verfolgt werden – das vorgestellte Netzwerk Inklusion ist hier nur ein Beispiel von vielen.
Der Arbeitskreis zur Erforschung der NS-„Euthanasie“ und Zwangssterilisation besteht seit 1983 und steht allen interessierten Personen offen. Er wird zweimal im Jahr von wechselnden Organisatoren veranstaltet.
Kontakt
Hagen Markwardt (Gedenkstätte Pirna-Sonnenstein, Öffentlichkeitsarbeit)
Tel. 03501 710963
presse.pirna@stsg.de